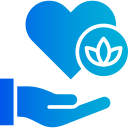Datenqualität, Bias und Fairness
Wenn Trainingsdaten bestimmte Altersgruppen, Ethnien oder Komorbiditäten unterrepräsentieren, entstehen blinde Flecken. Vielfalt in den Datensätzen, sorgfältige Dokumentation und externe Validierung helfen, dass die Systeme für alle Patientengruppen verlässlich und fair arbeiten.
Datenqualität, Bias und Fairness
Offene Protokolle zu Datenherkunft, Labeling und Modellgrenzen fördern verantwortungsvollen Einsatz. Sprechen Sie mit uns: Welche Fragen zu Fairness und erklärten Entscheidungen bewegen Ihr Team? Teilen Sie Erfahrungen, damit wir gemeinsam bessere Standards etablieren.